Gewalt gegen Frauen wird von der UN als eine der verbreitetsten und verheerendsten Menschenrechtsverletzung weltweit eingeordnet. Etwa ein Drittel aller Frauen erfährt mindestens einmal in ihrem Leben sexualisierte oder physische Gewalt. Die Angst vor Übergriffen ist für viele Frauen ständige Begleiterin und Maßnahmen, sich vor ihnen zu schützen, alltägliche einschränkende Routine. Dennoch wird Gewalt gegen Frauen nach wie vor verschwiegen, bagatellisiert oder als „Beziehungstat“ in die private Sphäre abgeschoben.
Der internationale Aktionstag am 25. November soll das Ausmaß dieser Gewalttaten ans Licht bringen und die gesamtgesellschaftliche und politische Verantwortung für ihre Bekämpfung unterstreichen. Der Aktionstag fordert auf, hinzuschauen und zu unterstützen, und betont den Mut von Betroffenen, die das Schweigen brechen. Durch den Tag wird aber auch aufgedeckt, dass es sich nicht um Einzeltaten handelt: In der Gewalt gegen Frauen offenbart und verfestigt sich eine strukturelle Geschlechterungleichheit.
Gewalt gegen Frauen tritt in vielen verschiedenen Erscheinungsformen auf. Sie unterscheiden sich stark, wurzeln aber alle in Machtungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Diese verschiedenen Formen schließen sich nicht gegenseitig aus: Mehrere Gewalttaten können gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig verstärken. Zudem erleben Frauen nicht ausschließlich Gewalt aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch weitere Ungleichheiten (etwa durch Rassismus oder Klassismus) können zu Gewalttaten führen. Dadurch erleben einige Frauen vielfältige und ineinandergreifende Formen von Gewalt.

Jede Handlung, die durch körperliche Gewalt körperlichen Schaden verursacht. Körperliche Gewalt kann unter anderem in Form von schweren und leichten Körperverletzungen, Freiheitsberaubung und Totschlag erfolgen.
Stoßen, Treten, Schlagen, mit Zigaretten verbrennen, Prügeln mit Gegenständen, Totschlag, Mord…

Jede sexuelle Handlung, die an einer Person ohne ihre Zustimmung vorgenommen wird. Sexualisierte Gewalt kann in Form von Vergewaltigung oder sexuellem Übergriff ausgeübt werden.
Belästigung, sexueller Missbrauch, erzwungenes Anschauen von Pornographie, versuchte Vergewaltigung, Vergewaltigung…

Jede Handlung, die einer Person psychischen Schaden zufügt. Psychische Gewalt kann z.B. in Form von Nötigung, Verleumdung, verbaler Beleidigung oder Belästigung auftreten.
Beleidigende Äußerungen und abwertende Kommentare, Kontaktverbote, Telefonverbote, Demütigung, Mobbing, Liebesentzug…

Ein Verhaltensmuster, das sich wiederholt und unerwünscht ist, wie z.B. unerwünschte Aufmerksamkeit, Kommunikation oder Kontakt.
Bespitzelung und Auflauern an der Wohnung oder am Arbeitsplatz, ständige Telefonanrufe, E-Mails oder andere Nachrichten, Belästigung in sozialen Medien, Sachbeschädigung…

Jede Handlung oder Verhaltensweise, die einer Person wirtschaftlichen Schaden zufügt. Wirtschaftliche Gewalt kann z.B. in Form von Sachschäden, der Einschränkung des Zugangs zu finanziellen Ressourcen, Bildung oder zum Arbeitsmarkt oder der Nichteinhaltung wirtschaftlicher Verantwortlichkeiten, wie z.B. Unterhaltszahlungen, auftreten.
Missbrauch der Verfügungsgewalt über finanzielle Mittel, Kontrolle über das Einkommen der Frau, Geld für den Unterhalt verweigern, einseitige Geheimhaltung von Einkommen und Vermögen…
Folgen der Gewalt
– Hämatome
– Quetschungen
– Narben
– Knochenbrüche
– Schädigungen innerer Organe
und Hirnschäden
– diffuse Unterleibs- und
Bauchbeschwerden auch
ohne diagnostische Ursache
– chronische Kopfschmerzen
– Unterleibsverletzungen
– Fehlgeburten
– verminderte Seh- und Hörfähigkeit
– chronische Schmerzen
– Tod
PSYCHISCH UND
PSYCHOSOMATISCH
– Angstzustände
– Albträume
– Schlaf- und Konzentrationsstörungen
– Depressionen
– Essstörungen
– Scham- und Schuldgefühle
– niedriges Selbstwertgefühl
– Verzweiflung
– Todeswünsche
WIRTSCHAFTLICH UND SOZIAL
– Rückzug und soziale Isolation
– Verzicht auf Unterhalts- oder
Schmerzensgeldzahlungen aus
Angst vor weiteren Misshandlungen
– Probleme am Arbeitsplatz
– Wohnungsverlust bis hin zur
Wohnungslosigkeit
– erhöhtes Armutsrisiko
Der Schmerz und das Leid der
Betroffenen lassen sich nicht in
Geldbeträgen ausdrücken –
aber Gewalt verursacht auch
gesellschaftliche Kosten:
– im Gesundheitswesen
– für Beratungseinrichtungen
– für Polizei und Justiz.

Patricia Mirabal
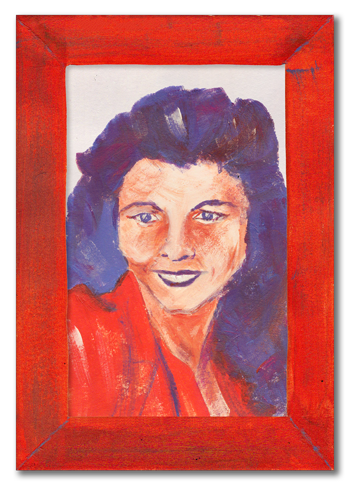
Minerva Mirabal
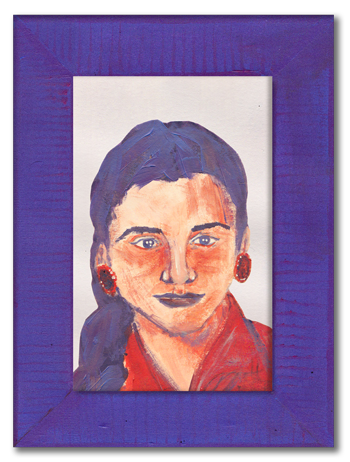
María Teresa Mirabal
Die Ermordung der Schwestern Mirabal
Der 25. November ist der internationale Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das Ziel ist, die fundamentalen Menschenrechte von Frauen immer wieder einzufordern und auf gesamtgesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Aber warum findet dieser jährliche Aktionstag gerade am 25. November statt?
Der bedrückende Ursprung des Aktionstages gegen Gewalt an Frauen liegt 60 Jahre zurück. Am 25. November 1960 wurden die drei Schwestern Patricia, Maria Teresa und Minerva Mirabal auf Anweisung des dominikanischen Diktators Rafael Leónidas Trujillo Molina ermordet.
Sie waren Teil der Speerspitze des Widerstands gegen Trujillo und kämpften für eine demokratische Dominikanische Republik in der Gruppe „Movimiento Revolucionario 14 de Junio“. Doch nicht nur deshalb waren sie Trujillo ein Dorn im Auge. Minerva Mirabal, eine der drei Schwestern, hatte die öffentlichen Annäherungsversuche des Diktators wiederholt zurückgewiesen.
Die Folge war die Überwachung und Unterdrückung Minervas. Sie wurde mehrmals inhaftiert und schließlich ließ Trujillo ihr sogar die Zulassung als Anwältin entziehen. Als die drei Frauen am 25. November 1960 ihre inhaftierten Ehemänner in der Hafenstadt Puerto Plata besuchen wollten, wurden sie auf dem Heimweg mitsamt ihrem Fahrer ermordet. Das Trujillo-Regime versuchte das Attentat zu verschleiern und sprach von einem fatalen Verkehrsunfall. Doch die Exhumierung brachte massive Spuren der zugefügten körperlichen Gewalt zutage.
Der Mord an den Schwestern Mirabal führte zu landesweiten Unruhen, die schließlich im Ende der Trujillo-Diktatur mündeten. Auf dem ersten Kongress lateinamerikanischer Feministinnen 1981 wurde auf Vorschlag der dominikanischen Schriftstellerin Angela Hernández Nuñez der Todestag der Schwestern zum symbolhaften Aktionstag gegen Gewalt an Frauen ernannt.
Frauen überall auf der Welt erleben geschlechtsspezifische Gewalt, weil ihr Recht auf Selbstbestimmung und ihre Grenzen von Männern nicht anerkannt und respektiert werden. Das ist auch 60 Jahre nach der Ermordung der Mirabal Schwestern noch immer lebensgefährliche Realität: Allein in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet (BKA 2018, S.26). Das zeigt, dass eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit den seit Jahrtausenden bestehenden misogynen Strukturen nach wie vor unverzichtbar ist, um diese gewaltvollen Muster zu durchbrechen.
Der Aktionstag gedenkt also nicht nur dem politischen Widerstand und dem Leben der Mirabal Schwestern. Er verdeutlicht darüber hinaus, dass ihr Schicksal auch das von Millionen Frauen weltweit ist. Ein Schicksal, das Frauen und Mädchen ereilt, wenn sie als zu laut empfunden werden, zu selbstständig, zu emanzipiert, zu politisch.Wenn sie nein sagen, wenn sie für sich einstehen.
Podcast
Ein kurzer Kommentar des SWR 2 zum 25. November bietet einen tiefer gehenden Einblick in die gewaltsame Geschichte und den historischen Kontext der Ermordung der Schwestern Mirabal. Darin kommt auch die vierte Schwester der Mirabal-Familie, Dedé Mirabal, zu Wort und erinnert an den unermüdlichen Widerstand ihrer Schwestern.
Häusliche
Gewalt
Häusliche Gewalt beschreibt eine spezielle Form der Gewalt gegen Frauen, die von (Ex-) Partner*innen ausgeht. Dabei kann häusliche Gewalt alle der bereits erwähnten Gewalt-Dimensionen umfassen und äußert sich nicht allein in Form von körperlicher oder sexualisierter Gewalt, sondern auch in verbalen Beleidigungen, der Kontrolle von sozialen Kontakten oder aber Drohungen bzw. Belästigung in Folge einer Trennung. Das Gravierende ist hierbei, dass die Vorfälle oftmals in privaten Räumen auftreten, im eigenen Zuhause, das eigentlich Schutz und Geborgenheit bieten sollte, und von Personen ausgehen, zu denen eine emotionale und vertrauensvolle Bindung besteht und die ein fester Bestandteil des eigenen Alltags sind.
Es ist für Betroffene aufgrund von vielschichtigen Abhängigkeitsmechanismen schwer, sich Gewalt-Situationen zu entziehen. Betroffene schildern dabei häufig, dass sich Formen häuslicher Gewalt über einen längeren Zeitraum entwickeln können und berichten von Schwierigkeiten, diese Gewaltspirale zu durchbrechen:
Die Gründe, warum betroffene Frauen die Beziehung nicht verlassen, sind vielfältig. Viele Täter zeigen ein ambivalentes Verhalten, wechseln zwischen liebevollem und gewaltaus-
übendem Partner hin und her. Nach einer Gewalthandlung äußern sie Bedauern, versprechen sich zu ändern. Andere Frauen fürchten die Reaktion auf einen Trennungsversuch, haben Angst davor, ihre Kinder zu verlieren oder gesellschaftliche Abwertung zu erfahren. (Steyer 2019)
Gleichzeitig kann es für Außenstehende komplizierter sein, diese Gewaltform überhaupt als solche zu erkennen bzw. wirkungsvoll einzugreifen und/oder unterstützend tätig zu werden.
Das Bundeskriminalamt veröffentlicht seit 2014 jährliche kriminalstatistische Auswertungen zum rund um das Thema Partnerschaftsgewalt. In der aktuellen Auswertung des Berichtsjahres 2018, werden folgende Straftatenbereiche berücksichtigt:
– Mord und Totschlag
– Körperverletzungen
– Sexuelle Übergriffe
– Sexuelle Nötigung
– Vergewaltigung
– Bedrohung
– Stalking und Nötigung
– Freiheitsberaubung
– Zuhälterei
– Zwangsprostitution
Der vom BKA festgestellte Anstieg in Partnerschaftsgewaltdelikten zwischen 2014
und 2018 (vgl. BKA 2018, S.21) lässt erahnen, dass zwar mittlerweile mehr Betroffene die Taten melden, die Gesamtzahl der Delikte jedoch in diesen Statistiken nur annähernd beschrieben werden kann, da es sich hier lediglich um gemeldete Fälle handelt. Statistisch gesehen, sind Frauen überdurchschnittlich oft Betroffene dieser Gewaltform und deutlich seltener Tatverdächtige. Allein in 2018 waren 114 393 der insgesamt 140 775 Betroffenen weiblich (BKA 2018, S.6).
»Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner.«
(BMFSFJ 2020)
Eine repräsentative Studie der Technischen Universität München hat zudem gezeigt, dass während der COVID 19-Pandemie in vielen Bundesländern ein Anstieg in Fällen häuslicher Gewalt zu beobachten ist. Da aufgrund von Job-Verlust, Home-Office, Kurzarbeit und/oder fehlender Kinderbetreuung die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme für Betroffene zusätzlich eingeschränkt werden, wird angenommen, dass die Dunkelziffer an Betroffenen noch deutlich höher ist (TU 2020).
Häusliche Gewalt hat auch Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld der Betroffenen, wie z. B. ihre Kinder. Sie werden in ihrer sozialen und kognitiven Entwicklung beeinträchtigt, entwickeln häufiger Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Kopf- und Bauchschmerzen. Die Folgen der erlebten Gewalt belasten viele Kinder ein Leben lang. Zudem wissen Expert*innen heute, dass Kinder, die Opfer oder Zeugen von häuslicher Gewalt waren, als Erwachsene ein höheres Risiko tragen, die erlebte Gewalt zu reproduzieren und selbst zu Betroffenen oder Täter* innen zu werden (vgl. Steyer 2019).
Es benötigt Mut und Kraft, eine gewaltbelastete Beziehung zu beenden und sich der Gewaltspirale zu entziehen. Dazu kommt, dass Betroffene oft nicht wissen, wo es Hilfe gibt und wen sie im Zweifelsfall kontaktieren können (TU 2020, Steyer 2019).
Eine sichere und mehrsprachige Anlaufstelle, an die Sie sich anonym und kostenlos wenden können, bildet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen.
Telefon 08000 116 016
Universitärer
Kontext
Das EU-geförderte Projekt „Gender Based Violence, Stalking and Fear of Crime“, geleitet durch den Lehrstuhl für Kriminologie der Ruhr-Universität Bochum, erhob 2009/2010 erstmalig qualitative und quantitative Daten über geschlechtsbezogene Gewalterfahrungen von Studentinnen an Hochschulen in sechs europäischen Ländern. In Deutschland nahmen 16 Hochschulen an der Befragung teil. Es wurden 12.700 Studentinnen zu ihren Erfahrungen zu sexueller Belästigung und Gewalt befragt:
Mehr als die Hälfte der
Studentinnen (54,7%)
gab an, dass sie sexuelle
Belästigung in der Zeit
ihres Studiums erlebt hatten.
In etwa jedem dritten
Fall kam die übergriffige
Person aus dem Umfeld
der Hochschule.
Sexueller Gewalt war laut
der Studie in etwa jede
Dreißigste der befragten
Studentinnen (3,3%) in
der Zeit ihres Studiums
ausgesetzt. In fast jedem
vierten Fall hiervon
kam die übergriffige Person
aus dem Umfeld der
Hochschule.
Mehr als die Hälfte der
Studentinnen (54,7%)
gab an, dass sie sexuelle
Belästigung in der Zeit
ihres Studiums erlebt hatten.
In etwa jedem dritten
Fall kam die übergriffige
Person aus dem Umfeld
der Hochschule.
Vergleich des Geschlechtes der
übergriffigen Person in den drei
Dimensionen sexuelle Belästi-
gung, Stalking und Sexuelle Ge-
walt(in Prozent)
Sexuelle Belästigung und Gewalt werden dieser Studie zufolge in erdrückender Mehrheit von Männern ausgeübt: So gingen 97,5% der Belästigungen und 96,6% der sexuellen Gewalt von Männern aus.
97,5%
2,5%
Sexuelle Belästigung
n=6668
90,9%
9,1%
Stalking
n=2476
96,6%
3,4%
Sexuelle Gewalt
n=354
Differenzierte Darstellung der übergriffigen Personen aus dem
Umfeld der Hochschule (in Prozent)
Im Hochschulkontext bestehen besondere Verwundbarkeiten von Studierenden in Bezug auf sexuelle Belästigung durch Lehr- und Betreuungspersonal, da Studierende (vor allem im Prüfungskontext) von dieser Personengruppe abhängig sind. Ähnliches gilt im Verhältnis zu anderen Hochschulangehörigen, etwa im Verwaltungsbereich.
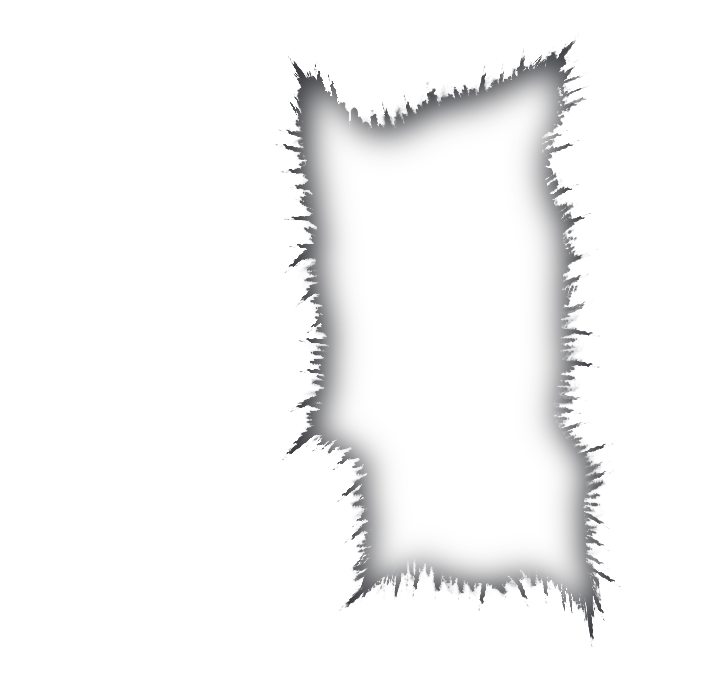

Gewalt gegen Frauen wird von der UN als eine der verbreitetsten und verheerendsten Menschenrechtsverletzung weltweit eingeordnet. Etwa ein Drittel aller Frauen erfährt mindestens einmal in ihrem Leben sexualisierte oder physische Gewalt. Die Angst vor Übergriffen ist für viele Frauen ständige Begleiterin und Maßnahmen, sich vor ihnen zu schützen, alltägliche einschränkende Routine. Dennoch wird Gewalt gegen Frauen nach wie vor verschwiegen, bagatellisiert oder als „Beziehungstat“ in die private Sphäre abgeschoben.
Der internationale Aktionstag am 25. November soll das Ausmaß dieser Gewalttaten ans Licht bringen und die gesamtgesellschaftliche und politische Verantwortung für ihre Bekämpfung unterstreichen. Der Aktionstag fordert auf, hinzuschauen und zu unterstützen, und betont den Mut von Betroffenen, die das Schweigen brechen. Durch den Tag wird aber auch aufgedeckt, dass es sich nicht um Einzeltaten handelt: In der Gewalt gegen Frauen offenbart und verfestigt sich eine strukturelle Geschlechterungleichheit.
Gewalt gegen Frauen tritt in vielen verschiedenen Erscheinungsformen auf. Sie unterscheiden sich stark, wurzeln aber alle in Machtungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Diese verschiedenen Formen schließen sich nicht gegenseitig aus: Mehrere Gewalttaten können gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig verstärken. Zudem erleben Frauen nicht ausschließlich Gewalt aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch weitere Ungleichheiten (etwa durch Rassismus oder Klassismus) können zu Gewalttaten führen. Dadurch erleben einige Frauen vielfältige und ineinandergreifende Formen von Gewalt.
Körperliche
Gewalt
Jede Handlung, die durch
körperliche Gewalt körperlichen
Schaden verursacht. Körperliche Gewalt kann unter anderem in Form von schweren und leichten Körperverletzungen, Freiheitsberaubung und
Totschlag erfolgen.
Stoßen, Treten, Schlagen, mit
Zigaretten verbrennen,
Prügeln mit Gegenständen, Totschlag, Mord…
Körperliche
– Hämatome
– Quetschungen
– Narben
– Knochenbrüche
– Schädigungen innerer Organe
und Hirnschäden
– diffuse Unterleibs- und
Bauchbeschwerden auch
ohne diagnostische Ursache
– chronische Kopfschmerzen
– Unterleibsverletzungen
– Fehlgeburten
– verminderte Seh- und Hörfähigkeit
– chronische Schmerzen
– Tod

Dimensionen
der Gewalt
Folgen der Gewalt



Belästigung
und Terror
(Stalking)
Ein Verhaltensmuster, das sich wiederholt und unerwünscht ist, wie z.B. unerwünschte Aufmerksamkeit, Kommunikation oder Kontakt.
Bespitzelung und Auflauern an der Wohnung oder am Arbeitsplatz, ständige Telefonanrufe,
E-Mails oder andere Nachrichten, Belästigung in sozialen Medien, Sachbeschädigung…
Sexualisierte
Gewalt
Jede sexuelle Handlung, die an einer Person ohne ihre Zustimmung vorgenommen wird. Sexualisierte Gewalt kann in Form von Vergewaltigung oder sexuellem Übergriff ausgeübt werden.
Belästigung, sexueller
Missbrauch, erzwungenes
Anschauen von Pornographie,
versuchte Vergewaltigung,
Vergewaltigung…
Psychische
Gewalt
Jede Handlung, die einer Person psychischen Schaden zufügt. Psychische Gewalt kann z.B. in
Form von Nötigung, Verleumdung, verbaler Beleidigung oder Belästigung auftreten.
Beleidigende Äußerungen und abwertende Kommentare,
Kontaktverbote, Telefonverbote, Demütigung, Mobbing, Liebesentzug…

Ökonomische
Gewalt
Jede Handlung oder Verhal-
tensweise, die einer Person
wirtschaftlichen Schaden zufügt. Wirtschaftliche Gewalt kann z.B. in Form von Sachschäden, der Einschränkung des Zugangs zu finanziellen Ressourcen, Bildung oder zum Arbeitsmarkt oder der Nichteinhaltung wirtschaftlicher Verantwortlichkeiten, wie z.B. Unter-haltszahlungen, auftreten.
Missbrauch der Verfügungsgewalt über finanzielle Mittel, Kontrolle über das Einkommen der Frau, Geld für den Unterhalt verweigern, einseitige Geheimhaltung von Einkommen und Vermögen…
Podcast
Ein kurzer Kommentar des SWR 2 zum 25. November bietet einen tiefer gehenden Einblick in die gewaltsame Geschichte und den historischen Kontext der Ermordung der Schwestern Mirabal. Darin kommt auch die vierte Schwester der Mirabal-Familie, Dedé Mirabal, zu Wort und erinnert an den unermüdlichen Widerstand ihrer Schwestern.
Die Ermordung der Schwestern Mirabal
Der bedrückende Ursprung des Aktionstages gegen Gewalt an Frauen liegt 60 Jahre zurück. Am 25. November 1960 wurden die drei Schwestern Patricia, Maria Teresa und Minerva Mirabal auf Anweisung des dominikanischen Diktators Rafael Leónidas Trujillo Molina ermordet.
Sie waren Teil der Speerspitze des Widerstands gegen Trujillo und kämpften für eine demokratische Dominikanische Republik in der Gruppe „Movimiento Revolucionario 14 de Junio“. Doch nicht nur deshalb waren sie Trujillo ein Dorn im Auge. Minerva Mirabal, eine der drei Schwestern, hatte die öffentlichen Annäherungsversuche des Diktators wiederholt zurückgewiesen.
Die Folge war die Überwachung und Unterdrückung Minervas. Sie wurde mehrmals inhaftiert und schließlich ließ Trujillo ihr sogar die Zulassung als Anwältin entziehen. Als die drei Frauen am 25. November 1960 ihre inhaftierten Ehemänner in der Hafenstadt Puerto Plata besuchen wollten, wurden sie auf dem Heimweg mitsamt ihrem Fahrer ermordet. Das Trujillo-Regime versuchte das Attentat zu verschleiern und sprach von einem fatalen Verkehrsunfall. Doch die Exhumierung brachte massive Spuren der zugefügten körperlichen Gewalt zutage.
Der Mord an den Schwestern Mirabal führte zu landesweiten Unruhen, die schließlich im Ende der Trujillo-Diktatur mündeten. Auf dem ersten Kongress lateinamerikanischer Feministinnen 1981 wurde auf Vorschlag der dominikanischen Schriftstellerin Angela Hernández Nuñez der Todestag der Schwestern zum symbolhaften Aktionstag gegen Gewalt an Frauen ernannt.
Frauen überall auf der Welt erleben geschlechtsspezifische Gewalt, weil ihr Recht auf Selbstbestimmung und ihre Grenzen von Männern nicht anerkannt und respektiert werden. Das ist auch 60 Jahre nach der Ermordung der Mirabal Schwestern noch immer lebensgefährliche Realität: Allein in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet (BKA 2018, S.26). Das zeigt, dass eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit den seit Jahrtausenden bestehenden misogynen Strukturen nach wie vor unverzichtbar ist, um diese gewaltvollen Muster zu durchbrechen.
Der 25. November ist der internationale Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das Ziel ist, die fundamentalen Menschenrechte von Frauen immer wieder einzufordern und auf gesamtgesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Aber warum findet dieser jährliche Aktionstag gerade am 25. November statt?
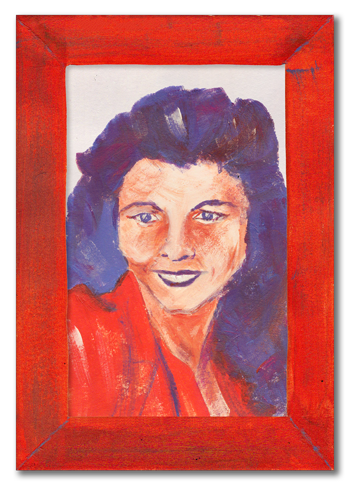
Minerva Mirabal

Patricia Mirabal
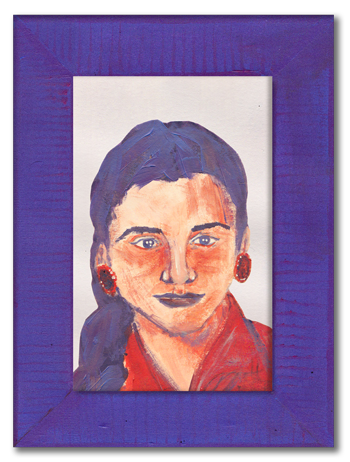
María Teresa Mirabal
Der Aktionstag gedenkt also
nicht nur dem politischen
Widerstand und dem Leben
der Mirabal Schwestern. Er
verdeutlicht darüber hinaus,
dass ihr Schicksal auch das
von Millionen Frauen welt-
weit ist. Ein Schicksal, das
Frauen und Mädchen ereilt,
wenn sie als zu laut empfun-
den werden, zu selbstständig,
zu emanzipiert, zu politisch.
Wenn sie nein sagen, wenn
sie für sich einstehen.
Jede vierte
Frau erlebt
häusliche
Gewalt

Häusliche
Gewalt
Häusliche Gewalt beschreibt eine spezielle Form der Gewalt gegen Frauen, die von (Ex-) Partner*innen ausgeht. Dabei kann häusliche Gewalt alle der bereits erwähnten Gewalt-Dimensionen umfassen und äußert sich nicht allein in Form von körperlicher oder sexualisierter Gewalt, sondern auch in verbalen Beleidigungen, der Kontrolle von sozialen Kontakten oder aber Drohungen bzw. Belästigung in Folge einer Trennung. Das Gravierende ist hierbei, dass die Vorfälle oftmals in privaten Räumen auftreten, im eigenen Zuhause, das eigentlich Schutz und Geborgenheit bieten sollte, und von Personen ausgehen, zu denen eine emotionale und vertrauensvolle Bindung besteht und die ein fester Bestandteil des eigenen Alltags sind.
Es ist für Betroffene aufgrund von vielschichtigen Abhängigkeitsmechanismen schwer, sich Gewalt-Situationen zu entziehen. Betroffene schildern dabei häufig, dass sich Formen häuslicher Gewalt über einen längeren Zeitraum entwickeln können und berichten von Schwierigkeiten, diese Gewaltspirale zu durchbrechen:
Der vom BKA festgestellte Anstieg in Partnerschaftsgewaltdelikten zwischen 2014
und 2018 (vgl. BKA 2018, S.21) lässt erahnen, dass zwar mittlerweile mehr Betroffene die Taten melden, die Gesamtzahl der Delikte jedoch in diesen Statistiken nur annähernd beschrieben werden kann, da es sich hier lediglich um gemeldete Fälle handelt. Statistisch gesehen, sind Frauen überdurchschnittlich oft Betroffene dieser Gewaltform und deutlich seltener Tatverdächtige. Allein in 2018 waren 114 393 der insgesamt 140 775 Betroffenen weiblich (BKA 2018, S.6).
»Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner.«
(BMFSFJ 2020)
Eine repräsentative Studie der Technischen Universität München hat zudem gezeigt, dass während der COVID 19-Pandemie in vielen Bundesländern ein Anstieg in Fällen häuslicher Gewalt zu beobachten ist. Da aufgrund von Job-Verlust, Home-Office, Kurzarbeit und/oder fehlender Kinderbetreuung die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme für Betroffene zusätzlich eingeschränkt werden, wird angenommen, dass die Dunkelziffer an Betroffenen noch deutlich höher ist (TU 2020).
Häusliche Gewalt hat auch Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld der Betroffenen, wie z. B. ihre Kinder. Sie werden in ihrer sozialen und kognitiven Entwicklung beeinträchtigt, entwickeln häufiger Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Kopf- und Bauchschmerzen. Die Folgen der erlebten Gewalt belasten viele Kinder ein Leben lang. Zudem wissen Expert*innen heute, dass Kinder, die Opfer oder Zeugen von häuslicher Gewalt waren, als Erwachsene ein höheres Risiko tragen, die erlebte Gewalt zu reproduzieren und selbst zu Betroffenen oder Täter* innen zu werden (vgl. Steyer 2019).
Es benötigt Mut und Kraft, eine gewaltbelastete Beziehung zu beenden und sich der Gewaltspirale zu entziehen. Dazu kommt, dass Betroffene oft nicht wissen, wo es Hilfe gibt und wen sie im Zweifelsfall kontaktieren können (TU 2020, Steyer 2019).
Eine sichere und mehrsprachige Anlaufstelle, an die Sie sich anonym und kostenlos wenden können, bildet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen.
Telefon 08000 116 016
Das Bundeskriminalamt veröffentlicht seit 2014 jährliche kriminalstatistische Auswertungen zum rund um das Thema Partnerschaftsgewalt. In der aktuellen Auswertung des Berichtsjahres 2018, werden folgende Straftatenbereiche berücksichtigt:
– Mord und Totschlag
– Körperverletzungen
– Sexuelle Übergriffe
– Sexuelle Nötigung
– Vergewaltigung
– Bedrohung
– Stalking und Nötigung
– Freiheitsberaubung
– Zuhälterei
– Zwangsprostitution
(ZEIT 2019; BKA 2018, S.28 f)
Die Kriminalstatistik
des BKAs besagt, dass
2018 in Deutschland
122 Frauen von ihren
Partnern oder Ex-Par-
tnern getötet wurden.
» ein Opfer
jeden
dritten
Tag«
Die Gründe, warum betroffene Frauen die Beziehung nicht verlassen, sind vielfältig. Viele Täter zeigen ein ambivalentes Verhalten, wechseln zwischen liebevollem und gewaltaus-
übendem Partner hin und her. Nach einer Gewalthandlung äußern sie Bedauern, versprechen sich zu ändern. Andere Frauen fürchten die Reaktion auf einen Trennungsversuch, haben Angst davor, ihre Kinder zu verlieren oder gesellschaftliche Abwertung zu erfahren. (Steyer 2019)
Gleichzeitig kann es für Außenstehende komplizierter sein, diese Gewaltform überhaupt als solche zu erkennen bzw. wirkungsvoll einzugreifen und/oder unterstützend tätig zu werden.
Universitärer
Kontext
Das EU-geförderte Projekt „Gender Based Violence, Stalking and Fear of Crime“, geleitet durch den Lehrstuhl für Kriminologie der Ruhr-Universität Bochum, erhob 2009/2010 erstmalig qualitative und quantitative Daten über geschlechtsbezogene Gewalterfahrungen von Studentinnen an Hochschulen in sechs europäischen Ländern. In Deutschland nahmen 16 Hochschulen an der Befragung teil. Es wurden 12.700 Studentinnen zu ihren Erfahrungen zu sexueller Belästigung und Gewalt befragt:
Mehr als jede Fünfte der
befragten Studentinnen
(22,8%) gab an, eine
Stalkingsituation in der
Zeit des Studiums erlebt
zu haben (in etwa jedem
dritten Fall davon aus
dem Umfeld der Hochschule).
Mehr als die Hälfte der
Studentinnen (54,7%)
gab an, dass sie sexuelle
Belästigung in der Zeit
ihres Studiums erlebt hatten.
In etwa jedem dritten
Fall kam die übergriffige
Person aus dem Umfeld
der Hochschule.
Sexueller Gewalt war laut
der Studie in etwa jede
Dreißigste der befragten
Studentinnen (3,3%) in
der Zeit ihres Studiums
ausgesetzt. In fast jedem
vierten Fall hiervon
kam die übergriffige Person
aus dem Umfeld der
Hochschule.
Vergleich des Geschlechtes der
übergriffigen Person in den drei
Dimensionen sexuelle Belästigung,
Stalking und Sexuelle Gewalt
(in Prozent)
Sexuelle Belästigung und Gewalt werden dieser Studie zufolge in erdrückender Mehrheit von Männern ausgeübt: So gingen 97,5% der Belästigungen und 96,6% der sexuellen Gewalt von Männern aus.
97,5%
2,5%
Sexuelle Belästigung
n=6668
90,9%
9,1%
Stalking
n=2476
96,6%
3,4%
Sexuelle Gewalt
n=354
Differenzierte Darstellung der übergriffigen Personen aus dem
Umfeld der Hochschule (in Prozent)
82,0%
8,3%
9,7%
90,5%
5,4%
4,1%
7,1%
85,8%
7,1%
Sexuelle Belästigung
n=2467
Stalking
n=784
Sexuelle Gewalt
n=84
Im Hochschulkontext bestehen besondere Verwundbarkeiten von Studierenden in Bezug auf sexuelle Belästigung durch Lehr- und Betreuungspersonal, da Studierende (vor allem im Prüfungskontext) von dieser Personengruppe abhängig sind. Ähnliches gilt im Verhältnis zu anderen Hochschulangehörigen, etwa im Verwaltungsbereich.
QUELLE 3: EU-Projekt: Gender-based Violence, Stalking and
Fear of Crime.Länderbericht Deutschland, 2012: 25
Orte, an denen die Studentinnen ihre subjektiv schwerwie-
gendste Situation sexualisierter Gewalt während der Zeit
des Studiums erlebt haben (in Prozent)
Nach den vorlie-
genden Daten sind
männliche Kommi-
litonen weit häufi-
ger Verursacher von
Übergriffen als Lehr-
personen. Von ihnen
gehen auch die
schwerwiegendsten
Übergriffe aus.
Nur ein geringer Teil aller sexuellen Übergriffe, die von den Befragten erfahren wurden, ereignete sich auf dem Gelände der Hochschulen. Bei sexueller Belästigung wurden 27,5% der schwerwiegendsten Situationen an der Hochschule erlebt, bei Stalking sind es 10,1%, bei sexueller Gewalt 5,3% der Fälle.
Unter den „Tatorten“ an Hochschulen wurden vor allem Studierendenwohnheime (4%) als Orte sexueller Gewalt, Außenanlagen der Hochschulen (9%) und Hörsäle/Seminarräume (6,3%) als Orte sexueller Belästigung erlebt. Mensen, studentische Fachschaftsräume, Bibliotheken und (Fakultäts-) Büros sind als Orte erlebter sexualisierter Übergriffe weniger signifikant.
Öffentlicher Ort (Straße, Park, Parkplatz)
Disco/Kneipe/Café
Außenanlage der HS
Öffentliche Verkehrsmittel
Hörsaal/Seminarraum
In/vor der eigenen Wohnung
Sonstiger Ort
Aufzug/Treppenhaus/Gang
Öffentliches Gebäude (z. B. Geschäft, …)
Arbeitsplatz
Fremde Wohnung
Mensa/Cafeteria
Telefon
Internet
Büro (z. B. Fakultät)
Bibliothek
Stud. Räume (z. B: Fachschaft)
Parkhaus/Parkplatz
Studentenwohnheim
Auto
Sporthalle/Umkleide
Toiletten
Sexualisierte Diskrimi-
nierung und Gewalt
am Arbeitsplatz
Was ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) spricht von sexueller Belästigung, wenn „[…] ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.“ § 3 Abs. 4 AGG
Ergebnisse einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vom Oktober 2019 zeigen: Jede*r Elfte der befragten Beschäftigten hat im Zeitraum der letzten drei Jahre am Arbeitsplatz unangemessene sexualisierte Kommentare oder Witze, unerwünschte belästigende Blicke, Gesten und Berührungen oder andere Formen sexueller Belästigung erlebt. Gut drei Viertel der Betroffenen waren Frauen (76%), knapp ein Viertel Männer (24%).
Frauen werden im Vergleich zu Männern häufiger durch Kolleg*innen oder Vorgesetzte einer höheren Hierarchiestufe sexuell belästigt. Männer mehr von gleichstellten Kolleg*innen.
QUELLE: Schröttle, Monika; Meshkova, Ksenia; Lehmann, Clara (2019): Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz – Lösungsstrategien und Maßnahmen zur Intervention. Eine Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Die WWU hat gemäß dem AGG eine Beschwerdestelle für Beschäftigte eingerichtet, bei der Beschäftigte Benachteiligungen „aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft,des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität“ anzeigen können. Sie finden den Kontakt zur Beschwerdestelle hier. Weitere mögliche Anlaufstellen der WWU und in Münster finden Sie am Ende der Ausstellung.

Art der sexuellen Belästigung
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nennt einige Beispiele sexueller Belästigung wie etwa Bemerkungen sexuellen Inhalts oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen. Es gibt noch einige weitere Formen. Bei sexueller Belästigung können drei Kategorien unterschieden werden: verbale, non-verbale und physische Belästigung.
Verbal
– sexuell anzügliche Bemerkungen
und Witze
– aufdringliche und beleidigende
Kommentare über die Kleidung, das
Aussehen oder das Privatleben
– sexuell zweideutige Kommentare
– Fragen mit sexuellem Inhalt, z. B.
zum Privatleben oder zur Intimsphäre
– Aufforderungen zu intimen oder
sexuellen Handlungen, z. B. „Setz dich
auf meinen Schoß!“
Non-verbal
– aufdringliches oder einschüchterndes
Starren oder anzügliche Blicke
– Hinterherpfeifen
– unerwünschte E-Mails, SMS, Fotos
oder Videos mit sexuellem Bezug
– unangemessene und aufdringliche
Annäherungsversuche in sozialen
Netzwerken- Scham- und Schuldgefühle
– Aufhängen oder Verbreiten
pornografischen Materials
– unsittliches Entblößen
Physisch
– jede unerwünschte Berührung
(Tätscheln, Streicheln, Kneifen,
Umarmen, Küssen), auch wenn die
Berührung scheinbar zufällig geschieht
– wiederholte körperliche Annäherung,
wiederholtes Herandrängeln,
wiederholt die übliche körperliche
Distanz (ca. eine Armlänge) nicht
wahren
– körperliche Gewalt sowie jede Form
sexualisierter Übergriffe bis hin zu
Vergewaltigung
Flirt oder
sexuelle
Belästigung?
Wo ist die
Grenze?
Im Alltagsverständnis wird sexuelle Belästigung oft mit physischer Gewalt gleichgesetzt. Sexuell übergriffiges und belästigendes Verhalten beginnt aber viel früher, auch wenn viele Formen sexueller Belästigung im Alltag nicht strafbar sind. Vor allem verbale und non-verbale Belästigungen werden immer wieder verharmlost. Den Betroffenen wird unterstellt, dass sie überempfindlich auf einen Witz oder Flirtversuch reagieren. Ein Flirt zum Beispiel hat nichts mit sexueller Belästigung zu tun. Er ist auch am Arbeitsplatz nicht verboten. Aber: Flirts entstehen in beiderseitigem Einverständnis. Übergriffiges Verhalten geschieht ohne das Einverständnis der anderen Person.
Es stimmt, es gibt keine 100-prozentig eindeutigen Regeln, was ein Kompliment ist und was nicht. Die Entscheidung, etwas als Kompliment zu verstehen, ist in hohem Maße subjektiv. Und das gilt selbstredend nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen, und selbstverständlich nicht nur in heterosexuellen Konstellationen – auch das kann nicht oft genug betont werden. Diese Subjektivität gilt es zu bewahren: Jede*r sollte die Deutungshoheit darüber behalten, was für sie oder ihn ein Kompliment ist und was nicht. Und das heißt eben auch: Selbst wenn eine Bemerkung als Kompliment gemeint war, kann sie anders ankommen. Ein Kompliment ist letztlich nichts anderes als eine Art Angebot, und Angebote können angenommen oder abgelehnt werden, ohne dass es dafür eine Rechtfertigung braucht.
Leitfaden der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes: Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?
> Link
Handreichung der Rosa Luxemburg-Stiftung: „Ist doch ein Kompliment – Behauptungen und Fakten über Sexismus“
> Link
Flirts
entstehen
in beider
seitigem
Einver-
ständnis.
Studierende und Beschäftigte können sich immer an die zentrale oder dezentrale Gleichstellungsbeauftragte der Fachbereiche wenden. Weitere Anlaufstellen an der WWU finden Sie auf unserer Homepage.
> Link
Wichtig: Der Dienstweg muss dabei nicht eingehalten werden. Es wird sichergestellt, dass den Betroffenen keine persönlichen oder beruflichen Nachteile entstehen und mögliche weitere Schritte im Einvernehmen der*des Betroffenen erfolgen.
Eine sichere und mehrsprachige Anlaufstelle, an die Sie sich anonym und kostenlos wenden können, bildet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
Telefon 08000 116 016
www.hilfetelefon.de
Die Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster für Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt
Telefon 0251/34443
www.frauennotruf-muenster.de
Neben Betroffenen finden auch Menschen aus dem jeweiligen familiären und sozialen Umfeld in diesem Rahmen Unterstützung und Hilfe.
Darüber hinaus finden Sie unter folgendem Link eine Liste von Anlaufstellen vor Ort. Dazu gehören u.a. die Frauenhausberatungsstelle Münster sowie Stellen der gesundheitlichen Versorgung im Gewaltfall:
www.frauennotruf-muenster.de/kontakt/adressenund-links
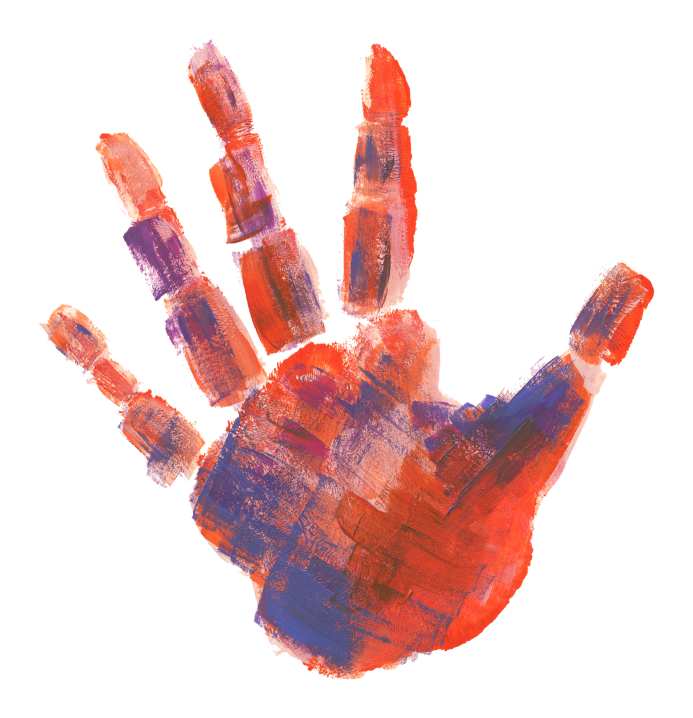
STOPPT
GEWALT
AN FRAUEN
Art der sexuellen Belästigung
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nennt einige Beispiele sexueller Belästigung wie etwa Bemerkungen sexuellen Inhalts oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen. Es gibt noch einige weitere Formen. Bei sexueller Belästigung können drei Kategorien unterschieden werden: verbale, non-verbale und physische Belästigung.
Verbal
– sexuell anzügliche Bemerkungen
und Witze
– aufdringliche und beleidigende
Kommentare über die Kleidung, das
Aussehen oder das Privatleben
– sexuell zweideutige Kommentare
– Fragen mit sexuellem Inhalt, z. B.
zum Privatleben oder zur Intimsphäre
– Aufforderungen zu intimen oder
sexuellen Handlungen, z. B. „Setz dich
auf meinen Schoß!“
Non-verbal
– aufdringliches oder einschüchterndes
Starren oder anzügliche Blicke
– Hinterherpfeifen
– unerwünschte E-Mails, SMS, Fotos
oder Videos mit sexuellem Bezug
– unangemessene und aufdringliche
Annäherungsversuche in sozialen
Netzwerken- Scham- und Schuldgefühle
– Aufhängen oder Verbreiten
pornografischen Materials
– unsittliches Entblößen
Physisch
– jede unerwünschte Berührung
(Tätscheln, Streicheln, Kneifen,
Umarmen, Küssen), auch wenn die
Berührung scheinbar zufällig geschieht
– wiederholte körperliche Annäherung,
wiederholtes Herandrängeln,
wiederholt die übliche körperliche
Distanz (ca. eine Armlänge) nicht
wahren
– körperliche Gewalt sowie jede Form
sexualisierter Übergriffe bis hin zu
Vergewaltigung
QUELLE: Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitgeber und Betriebsräte. Hg.
durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2020, S. 6
– sexuell anzügliche Bemerkungen
und Witze
– aufdringliche und beleidigende
Kommentare über die Kleidung, das
Aussehen oder das Privatleben
– sexuell zweideutige Kommentare
– Fragen mit sexuellem Inhalt, z. B.
zum Privatleben oder zur Intimsphäre
– Aufforderungen zu intimen oder
sexuellen Handlungen, z. B. „Setz dich
auf meinen Schoß!“
Physisch
Non-verbal
– aufdringliches oder einschüchterndes
Starren oder anzügliche Blicke
– Hinterherpfeifen
– unerwünschte E-Mails, SMS, Fotos
oder Videos mit sexuellem Bezug
– unangemessene und aufdringliche
Annäherungsversuche in sozialen
Netzwerken- Scham- und Schuldgefühle
– Aufhängen oder Verbreiten
pornografischen Materials
– unsittliches Entblößen
Verbal
– jede unerwünschte Berührung
(Tätscheln, Streicheln, Kneifen,
Umarmen, Küssen), auch wenn die
Berührung scheinbar zufällig geschieht
– wiederholte körperliche Annäherung,
wiederholtes Herandrängeln,
wiederholt die übliche körperliche
Distanz (ca. eine Armlänge) nicht
wahren
– körperliche Gewalt sowie jede Form
sexualisierter Übergriffe bis hin zu
Vergewaltigung
Art der sexuellen Belästigung
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nennt einige Beispiele sexueller Belästigung wie etwa Bemerkungen sexuellen Inhalts oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen. Es gibt noch einige weitere Formen. Bei sexueller Belästigung können drei Kategorien unterschieden werden: verbale, non-verbale und physische Belästigung.
Flirts
entstehen
in beider
seitigem
Einver-
ständnis.
Flirt oder sexuelle
Belästigung?
Wo ist die Grenze?
Im Alltagsverständnis wird sexuelle Belästigung oft mit physischer Gewalt gleichgesetzt. Sexuell übergriffiges und belästigendes Verhalten beginnt aber viel früher, auch wenn viele Formen sexueller Belästigung im Alltag nicht strafbar sind. Vor allem verbale und non-verbale Belästigungen werden immer wieder verharmlost. Den Betroffenen wird unterstellt, dass sie überempfindlich auf einen Witz oder Flirtversuch reagieren. Ein Flirt zum Beispiel hat nichts mit sexueller Belästigung zu tun. Er ist auch am Arbeitsplatz nicht verboten. Aber: Flirts entstehen in beiderseitigem Einverständnis. Übergriffiges Verhalten geschieht ohne das Einverständnis der anderen Person.
Es stimmt, es gibt keine 100-prozentig eindeutigen Regeln, was ein Kompliment ist und was nicht. Die Entscheidung, etwas als Kompliment zu verstehen, ist in hohem
Maße subjektiv. Und das gilt selbstredend nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen, und selbstverständlich nicht nur in heterosexuellen Konstellationen – auch das kann nicht oft genug betont werden. Diese Subjektivität gilt es zu bewahren: Jede*r sollte die Deutungshoheit darüber behalten, was für sie oder ihn ein Kompliment ist und was nicht. Und das heißt eben auch: Selbst wenn eine Bemerkung als Kompliment gemeint war, kann sie anders ankommen. Ein Kompliment ist letztlich nichts anderes als eine Art Angebot, und Angebote können angenommen oder abgelehnt werden, ohne dass es dafür eine Rechtfertigung braucht.
Leitfaden der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes: Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?
> Link
Handreichung der Rosa Luxemburg-Stiftung: „Ist doch ein Kompliment – Behauptungen und Fakten über Sexismus“
> Link
Ansprechpartner*innen
für Betroffene
Studierende und Beschäftigte können sich immer an die zentrale oder dezentrale Gleichstellungsbeauftragte der Fachbereiche wenden. Weitere Anlaufstellen an der WWU finden Sie auf unserer Homepage.
> Link
Wichtig: Der Dienstweg muss dabei nicht eingehalten werden. Es wird sichergestellt, dass den Betroffenen keine persönlichen oder beruflichen Nachteile entstehen und mögliche weitere Schritte im Einvernehmen der*des Betroffenen erfolgen.
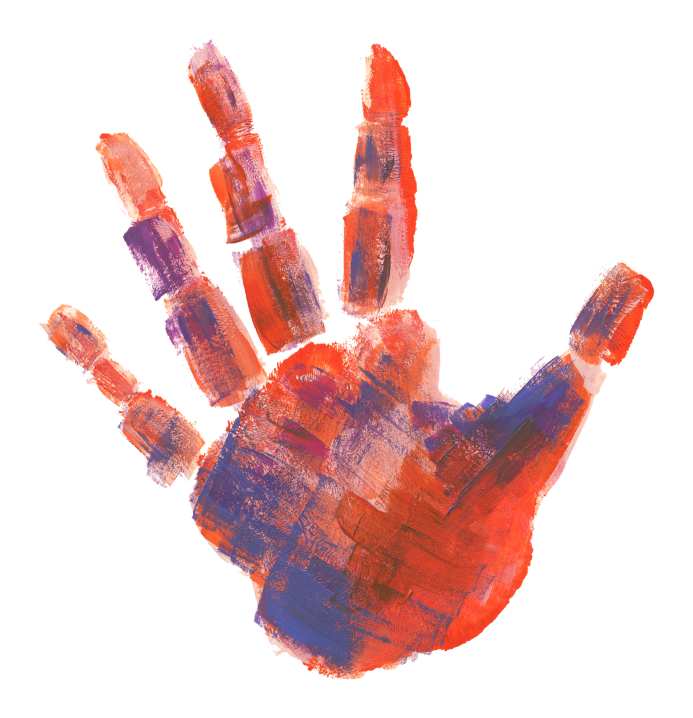
STOPPT
GEWALT
AN FRAUEN
Anlaufstellen
außerhalb der WWU:
Eine sichere und mehrsprachige Anlaufstelle, an die Sie sich anonym und kostenlos wenden können, bildet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
Telefon 08000 116 016
www.hilfetelefon.de
Die Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster für Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt
Telefon 0251/34443
www.frauennotruf-muenster.de
Neben Betroffenen finden auch Menschen aus dem jeweiligen familiären und sozialen Umfeld in diesem Rahmen Unterstützung und Hilfe.
Darüber hinaus finden Sie unter folgendem Link eine Liste von Anlaufstellen vor Ort. Dazu gehören u.a. die Frauenhausberatungsstelle Münster sowie Stellen der gesundheitlichen Versorgung im Gewaltfall:
www.frauennotruf-muenster.de/kontakt/adressenund-links
Ansprechpartner*innen
für Betroffene
Studierende und Beschäftigte können sich immer an die zentrale oder dezentrale Gleichstellungsbeauftragte der Fachbereiche wenden. Weitere Anlaufstellen an der WWU finden Sie auf unserer Homepage.
> Link
Wichtig: Der Dienstweg muss dabei nicht eingehalten werden. Es wird sichergestellt, dass den Betroffenen keine persönlichen oder beruflichen Nachteile entstehen und mögliche weitere Schritte im Einvernehmen der*des Betroffenen erfolgen.
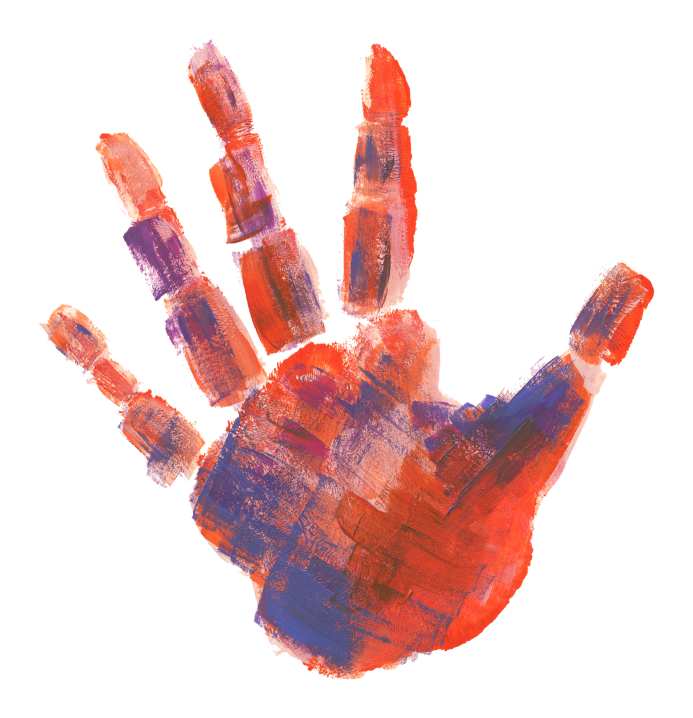
Anlaufstellen
außerhalb der WWU:
Eine sichere und mehrsprachige Anlaufstelle, an die Sie sich anonym und kostenlos wenden können, bildet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
Telefon 08000 116 016
www.hilfetelefon.de
Die Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster für Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt
Telefon 0251/34443
www.frauennotruf-muenster.de
Neben Betroffenen finden auch Menschen aus dem jeweiligen familiären und sozialen Umfeld in diesem Rahmen Unterstützung und Hilfe.
Darüber hinaus finden Sie unter folgendem Link eine Liste von Anlaufstellen vor Ort. Dazu gehören u.a. die Frauenhausberatungsstelle Münster sowie Stellen der gesundheitlichen Versorgung im Gewaltfall:
www.frauennotruf-muenster.de/kontakt/adressenund-links
STOPPT
GEWALT
AN FRAUEN
Quellen
1.
Bericht zur Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamts – Berichtsjahr 2018:
> Link
Artikel „Der gewaltsame Tod der Schmetterlinge“ von Hans-Ulrich Dillmann – 2006:
> Link
2.
Artikel zum Thema häusliche Gewalt in der Pharmazeutischen Zeitung von Carina Steyer:
> Link
Bericht zur Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamts – Berichtsjahr 2018:
> Link
Häusliche Gewalt als Form der Gewalt gegen Frauen, Hilfetelefon des BMSFSJ:
> Link
Hintergrundmeldung zum Thema häusliche Gewalt, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche (BMFSFJ):
> Link
Interview mit Professorin Janina Steinert, Co-Autorin der Studie „The Impact of COVID-19 on Violence against Women and Children in Germany“:
> Link
Pressemeldung der TU München vom 02.06.2020:
> Link
Zeit-Artikel bzw. Dokumentation zum Thema Femizide in Deutschland von Elisabeth Raether und Michael Schlegel:
> Link
3.
Gender-based Violence, Stalkingc
and Fear of Crime.Länderbericht Deutschland, 2012: 25
> Link
4.
Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitgeber und Betriebsräte. Hg.durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2020, S. 6
> Link
5.
Leitfaden der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes: Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?
> Link
Handreichung der Rosa Luxemburg-Stiftung: „Ist doch ein Kompliment – Behauptungen und Fakten über Sexismus“
> Link
